(Ent-)Demokratisierung der Demokratie
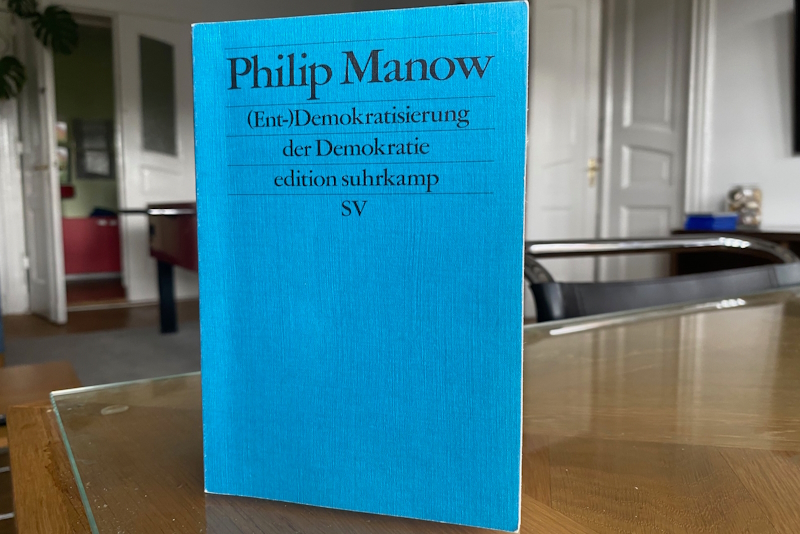
Der Politologe Philip Manow warf bereits 2020 einen besonderen Blick auf den Populismus: in seiner Argumentation ist der aktuelle Populismus weniger der Gegner als ein Krisensymptom der aktuellen, defekten repräsentativen Demokratie.
„Seine zentrale These lautet, dass sich im Populismus zwei Prozesse bündeln. Der Populismus unserer Gegenwart konfrontiert uns mit der widersprüchlichen Gleichzeitigkeit, aber auch mit dem latenten Zusammenhang von zwei Entwicklungen, die ich Demokratisierung und Entdemokratisierung der Demokratie nennen möchte“ (S. 13).
Er belegt ausführlich, dass die Demokratie sich in den letzten Jahrzehnten demokratisiert habe, indem immer mehr Schranken abgeschafft wurden, die es bisher schlechter Gestellten wie Frauen, weniger Gebildeten oder Armen ermöglichten, stärker an der Demokratie teilzuhaben. Und selbst Autokratien würden sich heute auf demokratische Prinzipien wie Wahlen und Mehrheiten stützen, wenn auch nur scheinbar. Die neuen populistischen Bewegungen seien Gegner der repräsentativen, aber nicht der Demokratie an sich, sondern behaupteten, sie verträten die wahre Demokratie (S. 17).
Repräsentation als Mittel, das Volk von der Herrschaft fernzuhalten
Nicht die Demokratie, sondern die Repräsentation sei in der Krise, diese These entfaltet Manow breit und gut belegt: Lange wurde Demokratie mit Volks- oder besser mit Pöbelherrschaft gleichgesetzt: seit der Antike scheute man es, dem Volk die Macht zu überlassen, weil es dafür zu ungebildet, unreif sei und zu sehr Demagogen folge (S. 30f.). Das Gegenmittel sei Repräsentation, die dafür sorge, dass Eliten und nicht die kleinen Leute den Ton angeben. Ob französische oder amerikanische Republik, in beiden hätten die Gründerväter die Macht so verteilt, dass das Volk sich nicht selbst regieren könne: „Als Antwort auf Vorbehalte gegen die „Volksherrschaft“.. nahm die Demokratie .. eine Zweiteilung vor, und zwar in einen repräsentierbaren und einen nicht repräsentierbaren Teil“ (S. 37). Ob Kant, Hegel oder Marx, überall verschwand hinter dem Bürger, dem citoyen, dem Volk, der reale Pöbel, die kleinen Leute, die Massen. „Der gleichzeitige Ein- und Ausschluss des Volkes als Volk und Pöbel steht am Anfang der Demokratie, ist für sie konstitutiv.. es ist der Trick der Repräsentation, etwas in der Demokratie beständig Anwesendes (die kleinen Leute, die Massen, SG) abwesend zu halten“ (S. 46f.).
Nach 1945 senkten Massenparteien die Schranken, die Globalisierung vergrößerte diese wieder
Doch den Honoratiorenparteien des 19. Jahrhunderts folgten die Massenparteien, die nach 1945 jeden Ausschluss abräumten: Frauen durften wählen, Arme, Ungebildete, Ausländer, Menschen mit Behinderungen usw. Und bis in die 80er Jahre waren die Bürger zufrieden und wählten mit 80, 90 Prozent die Parteien, die diese Schranken niederrissen. Doch „ist die demokratische Inklusion mehr oder weniger vollständig gewährt, gewinnt eine andere Lösungsmöglichkeit an Bedeutung: die Depolitisierung von Entscheidungsfragen, ihre Herausnahme aus dem Bereich demokratischer Verfügung: durch Verrechtlichung, durch Konstitutionalisierung, durch Delegation an nichtmajoritäre Institutionen etc. – und durch Globalisierung bzw. Europäisierung“ (S. 54f.). All dies geschah in der neoliberalen Ära – zu Lasten der sog. kleinen Leute: Durch Finanzmärkte usw. wurde die politische Verhandlungsmasse immer kleiner und ungleicher verteilt für die Top ten oder das oberste Prozent.
Die etablierten Parteien verloren die Bindung zum Volk und wurden neoliberale Staatsparteien
Dabei sieht Manow „die Krise der Repräsentation .. als Konsequenz von zwei miteinander verbundenen Veränderungsprozessen ..: die vielfach diagnostizierte Krise der politischen Organisationsform Partei und ein abermals sich vollziehender „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (S. 57): Er beschreibt Parteien als „essenziell für die repräsentative Demokratie“, da sie „das Funktionieren der Repräsentation unter den Bedingungen moderner Massendemokratie gewährleisten“ (S. 59) – oder eben nicht mehr, mit gewichtigen Folgen. „Parteien verbinden zwei grundsätzliche Funktionen .. sie repräsentieren gesellschaftliche Interessen und regieren dann in deren Sinne – so war es zumindest lange Zeit. Demokratische Responsivität und Verantwortlichkeit des Exekutivhandelns werden dadurch gesichert, dass diejenigen, die an der Macht sind, abgewählt werden können.. Wahlen, das ist der zentrale Mechanismus der Demokratie – und er wirkt .. beständig, weil eine Regierung immer wieder .. auf die Bildung einer parlamentarischen Mehrheit angewiesen ist“ (S. 60f.). Dabei stehen Neuwahlen immer als Möglichkeit disziplinierend im Raum.
Parteien ohne Milieubindung prämiieren populistische Leitfiguren wie Corbyn, Trump
Um „liefern zu können“, brauchen Parteien Geschlossenheit nach innen und Überzeugungskraft nach außen. „Zu besichtigen ist momentan, was mit der repräsentativen Demokratie geschieht, wenn Parteien die in der repräsentativen Demokratie anfallenden multiplen politischen Koordinierungsfunktionen immer weniger zu erfüllen vermögen“ (S. 69). Laut vielen Beobachtern ist die alte „party over“, wie man an der Führungsauslese sehen kann: Die Labourparty suchte mit Corbyn nicht einen mehrheitsfähigen Premier, sondern einen charismatischen linken Anführer. Der Kandidat war im Vorteil, der „eher die Seele der Partei anzusprechen vermochte – also die Prämiierung der extremeren politischen Position, der reinen Lehre“ (S. 74). Dem zuvor ging der Einflussverlust des alten Parteiestablishments sowie der organisierten Interessen, hier der Gewerkschaften. In den früheren Massenparteien waren noch die Wählbarkeit für alle bei Anbindung an Massenorganisationen wie Gewerkschaften (links) und Kirche (rechts) wichtig gewesen.
Staatsparteien zerfallen in „verstaatlichte“ brave Führung und rebellische Basis
Im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts wurde die Massen- von der sog. Kartellpartei abgelöst: angesichts sich auflösender Milieus und unsicherer Wählerschaften sollten staatliche Ressourcen den Verlust an gesellschaftlicher Bindung ausgleichen: „das Geld, die Verfügung über die Stellen, die Macht waren nun vornehmlich in den Händen der nationalen Parteiführung zentralisiert. Je mehr sich aber die etablierten Parteien mit dem Staat verbanden, desto bedeutungsloser wurde der Wettbewerb zwischen ihnen“ (S. 80). Einmal, weil sich bestimmte Konflikte wie Markt versus Staat, kaum noch stellten, andererseits weil die Handlungsspielräume immer mehr internationalen Kräften, der Justiz usw. überlassen wurden. „Zugleich aber wird das Verhältnis von Parteiführung und Parteibasis.. immer problematischer, spannungsgeladener.. Die Parteiführung ist ihr (der Basis, SG), aber dann auch der breiteren Wählerschaft gegenüber nicht mehr repräsentativ“ (S. 81).
Mit neuen Medien und Wählern überflügeln Populisten die etablierten Parteien
„Im Ergebnis werden mehr und mehr Fragen .. durch die Basis entschieden .. Das liberale Modell der Führungsauslese sei heute „stärker an kurzfristigen Mobilisierungseffekten orientiert, nicht mehr hierarchisch, sondern dezentral, nun völlig „demokratisch“ (S. 83f.). Ironisch notiert Manow, es scheine, „als würde die Demokratie eher Schaden nehmen, wenn auch Parteien das sind: durch und durch demokratisch verfasst“ (Ebda.). Er beschreibt das am Beispiel von Trump, der die Republikaner von außen, über die Vorwahlen aufgerollt hat. Dabei spielten die neuen sozialen Medien eine größere Rolle als Geld: Manow zeigt, dass Trump anfangs mit Kleinspenden der kleinen Leute die großen Summen auch von Hillary Clinton auskonterte (S. 91ff.): „Wenn die Hauptkonfliktlinie nicht länger zwischen (gemäßigt) links und (gemäßigt) rechts verläuft, sondern zwischen der Verteidigung des Status quo und seiner radikalen Infragestellung, .. dann gelten die zentripetalen Vorhersagen des Median voter-Theorems (d.h. man wählt den Mittekandidaten, SG) offensichtlich nicht mehr“ (S. 94). Den Geldmangel mache „eine neue Währung (..) wett: Medienaufmerksamkeit“ (S. 98). Manow beschreibt, wie die etablierten Medien zwar Trump ablehnten, sich aber obsessiv mit ihm befassten: „Polarisierung etablierte sich als Geschäftsmodell“ (S. 100). Das hatte „Rückwirkungen auf das Elektorat selbst, die Polarisierungen verfestigten sich auch in der Wählerschaft“, und die gewählten „extremeren“ Abgeordneten verschärften wiederum die Polarisierung im Kongress (S. 101f.). Am Beispiel Macron zeigt Manow, wie ein Kandidat rasch das alte Parteiensystem sprengen und mit einer auf ihn zugeschnittenen Partei Mehrheiten gewinnen kann: „Parteien werden immer mehr zu Bewegungen“ (S. 109, zu personenzentrierten, wie man von Farage über Meloni bis Orban sieht, SG).
Fazit: Wenn die alten Kräfte zunehmend obsolet werden (Parteiführungen, Medien usw.), kann neue Politik die alten Medien umgehen und kommuniziert direkt mit ihrem Publikum: „Organisation (wird) durch Person substituiert“ (S. 111). Wo der Diskurs sich verflüchtigt hat, .. soll er nachgestellt werden“ – durch Townhall meetings, truth social usw., wobei real nur der Führer für das Volk spricht.
Die Rede von Demokratiefeinden spielt eben diesen in die Hände
„Politische Macht in der Demokratie“, so Manow, „wird jeweils mit Worten gefüllt“ (S: 122). In der repräsentativen Demokratie spricht statt des Volkes die Mehrheit, deren Antwort ist „aber immer nur vorläufige, zeitlich begrenzte – und ihre Akzeptanz beruht auf genau dieser Vorläufigkeit .. Demokratie beweist sich im regelkonform durch Wahlen vollzogenen Machtwechsel (S. 123f.). Dabei wissen wir nie, ob wir noch in demokratischen Verhältnissen leben oder nicht mehr (siehe Trumps USA, SG). Hier entscheiden Richter, ob der Präsident rechtmäßig handelt. „Die beständige Gefahr besteht darin, dass die Feinde der Demokratie im Namen der Demokratie die Demokratie kapern können“ – was dem einen ein Putsch ist, ist dem anderen ein Befreiungsakt, siehe der Sturm auf das Kapitol 2021. Umsturzängste begleiten die Demokratie von Beginn an. Hat der Populist angefangen, die Parteien, Eliten usw. als Feinde der wahren Demokratie zu geißeln, antworten diese ihrerseits mit gleichen Vorwürfen. „Das führt zur Paradoxie: Von den Gegnern der Demokratie zu sprechen zerstört die Demokratie ebenso, wie von den Gegnern der Demokratie zu schweigen“ (S. 144, so gesehen ist es schlimm, wenn das neualte Bündnis von Union und SPD als „letzte Chance der Demokratie“ bezeichnet wird: was, wenn diese Regierung scheitert, ist unsere Demokratie dann am Ende? SG).
Demokratie im Dauerbürgerkrieg ist so unmöglich wie ohne Staaten
Manow fragt, wovon wir nicht reden, wenn wir vom Kampf der Demokraten gegen Antidemokraten reden? In USA z.B. von der ungeheuren Ungleichheit, die von Hillary Clinton mindestens so ungefragt hingenommen wurde wie von Trump, weshalb sie viel mehr Großspenden erhielt (S. 147). „Neu scheint, dass .. der Verdacht allgegenwärtig wird und die Vorstellung demokratischer Gleichheit, die Isonomie, unterminiert.“ Dies liege an der Schwäche der repräsentativen Kräfte, aber auch, „weil mit dem Staat die äußere Form der Demokratie in die Krise gerät“ (S. 152): Die Erosion der nationalen Souveränität, zitiert er seinen Kollegen Brown, „durch die Globalisierung und die Beschneidung der souveränen Macht der Nationalstaaten (sind) entscheidende Faktoren für die aktuelle Entdemokratisierung des Westens .. Damit das Volk sich selbst regieren kann, muss es erstens ein Volk sein, und zweitens Zugang zu jenen Gewalten haben, die es demokratisieren soll. Die Erosion der nationalstaatlichen Souveränität durch die Globalisierung untergräbt das erstere, die Entfesselung der Macht des Kapitals zur unkontrollierten Weltmacht eliminiert das letztere Prinzip“ (S. 155f.). Manow zeigt auf, dass „überhaupt nur aufgrund seiner Eingrenzung der Staat Verallgemeinerungsinstanz werden (konnte)“ (S. 158), es gebe keine moderne Demokratie ohne Staat (S. 162). Der europäische Universalismus – auch in Form der EU – habe sich auf Kosten der Staaten entwickelt, „die Verlustrechnung dieser „Dekonsolidierung nationaler Territorialität“, die eben vor allem eine demokratische Verlustrechnung ist, werde vom Populismus präsentiert (S. 168).
Demokratie, mahnt Manow, sei „an starke institutionelle Rahmungen gebunden, die Gleichheit strukturell garantieren, anstatt sie auf moralische Ansprüche zu reduzieren, die diejenigen privilegiert vortragen können, die dazu besonders ausgebildet sind“ (S. 169, daher ist es fatal, wenn z.B. die Politikelite den Schutz ihrer Bürger vor Klimawandelfolgen vermeidet, weil sie Wirtschaft wichtiger findet: das ist eine größere Gefahr für die Demokratie als die Attacken von Weidel und Co., SG).
Populismus als Krisensymptom der Eliten- und Vollender der Volksherrschaft?
Manows These lautet „im Kern, dass eine .. Ausweitung der Partizipationschancen die institutionellen Funktionsbedingungen der Demokratie zu bedrohen scheint, insbesondere wenn sie auf eine Konstellation trifft, in welcher der Staat .. zunehmend an Bedeutung verliert .. Der Pöbel kehrt lautstark wieder, weil die Macht keine Integrationsangebote mehr unterbreiten will oder kann, die auf Gemeinsamkeiten beruhen“ (S. 171f.). Das Politische und die Politik, so Manow, „werden gern gegeneinander ausgespielt – und das geht in der betreffenden Literatur immer zugunsten des Politischen und zulasten der Politik aus“ (S. 172). Er zeigt das an der Geringschätzung, mit der ein Slavo Zizek die formale Politik abbügelt: „Was zählt, ist nicht die Art und Weise, wie die Regierung gewählt wird, sondern der Druck, der durch die Mobilisierung und Selbstorganisation des Volkes auf sie ausgeübt wird“. Manow dazu: „Wenn die Art und Weise, wie die Regierung gewählt wird, gar nicht zählt, ist es eigentlich auch egal, ob eine Regierung überhaupt gewählt wird“ (S. 173). Die Zeiten seien vorbei, als man „die Verachtung der Institutionen zum Geschäftsmodell seiner intellektuellen Brillianz machen konnte: „Angebrochen sind hingegen Zeiten, die in spezifischer Weise aus dem Gleichgewicht geraten zu sein scheinen. Die fehlende Balance ist aber .. durch die Diagnose „Krise der Demokratie“ nur unpräzise und daher potenziell irreführend eingeordnet. Hier wurde stattdessen die These entwickelt, dass wir nicht nur mit keiner Krise der Demokratie konfrontiert sind, sondern ganz im Gegenteil mit einer Demokratisierung der Demokratie, die sie aus ihrer institutionellen und konstitutionellen Einhegung .. mehr und mehr hinausführt.“ (S. 174).
Manow hat eine plausible Theorie der Demokratiekrise verfasst, die Populismus nicht als Gegner der Demokratie, sondern als Vollender der Demokratisierung und Gegner der repräsentativen Einhegung des Volkes durch (neo-)liberale Eliten beschreibt. Das mag vielen nicht schmecken, die sich gern als Verteidiger der Demokratie gegen AfD und andere „Feinde der Demokratie“ gerieren. Tatsächlich müssen sich gerade liberale Bildungsbürger genau überlegen, wo sie die Gegner der Demokratie verorten und wie sie gegen diese zu Felde ziehen. Anders gesagt: Ohne Klingbeil, Merz und Co könnten Weidel u.a. nie Erfolge feiern. Oder: Wer die Infrastrukturen derart hat verkommen lassen wie die bisherigen Regenten, ohne auf die Betroffenen zu hören, sollte mit dem Etikett „Feinde der Demokratie“ vorsichtig umgehen. Bleibt der Hinweis, dass der Populismus kein Endstadium der Demokratie sein darf: wir alle müssen politische Verhältnisse und staatliche Strukturen anstreben, die Figuren wie Farage, Meloni, Orban und Trump überflüssig machen, weil Politik Volkes Willen umzusetzen versucht. Dazu braucht es wohl andere Politiker/innen, Parteien und politische Prozesse.