Europa – ein zweites Nordkorea?
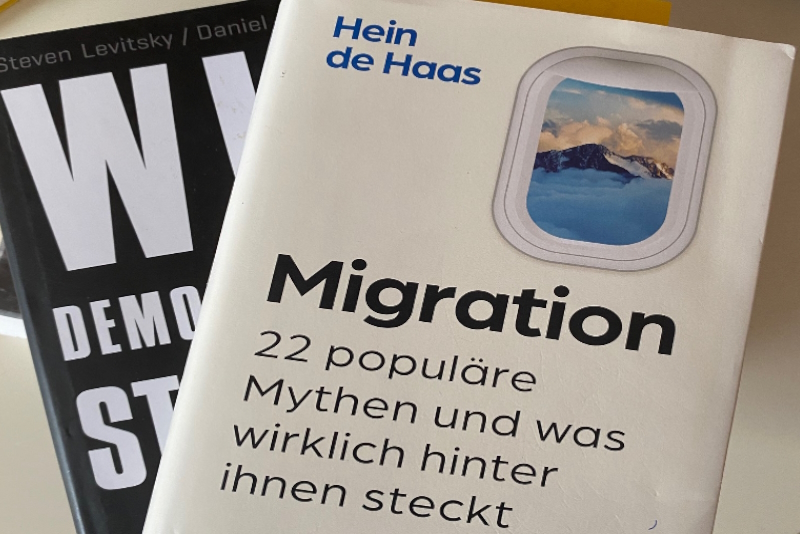
Im Spiegel vom 12.05.2024 führte Steffen Lüdke ein Interview mit Hein de Haas über sein aktuelles Buch „Migration – 22 populäre Mythen und was wirklich hinter ihnen steckt“ und eine verfehlte europäische Politik, die den Kontinent gegenüber Flüchtigen und Migranten abschotten will.
Hein de Haas hält diese Form einer >Festung Europa< für keine Möglichkeit, irreguläre Zuwanderung zu verringern. Im Gegenteil führt diese europäische Migrationspolitik dazu, dass immer mehr Menschen den Weg der irregulären Einwanderung nutzen.
Auf die Frage, warum er sein Buch an Bürger und nicht an Politiker richte und ob er „die Hoffnung verloren (hätte), dass Regierungschefs und Parlamentarier auf (ihn) hören (würden)“, antwortete De Haas, dass des es für einen Politiker unmöglich sei, sich gegen die aktuelle Migrationspolitik auszusprechen. Dem Zugeständnis, dass diese „sich zu sehr von der Realität entfremdet“ habe, käme einem „politischen Selbstmord“ gleich.
Es gibt keine Flüchtlingskrise – es gibt eine Integrationskrise
Natürlich sind die Probleme der Europäer mit der „Flüchtlingskrise“ „real“, wenn die hier vor Krieg in ihren Heimatländern geflüchteten Syrer und Afghanen ihre Verwandtschaften nachholen: „Dieser Netzwerkeffekt ist neben Krieg und Unterdrückung einer der Gründe für die hohen Asylzahlen im Land.“ Aber es ist weniger einer Frage der Anzahl der Menschen, die Asyl beantragen, als ein europäisches „Managementproblem“.
Nach De Haas ist es ist in der Tat so, dass die >Lasten der Integration< ungleich verteilt sind: so ist es unbestreitbar, dass Besserverdiener von Immigranten profitieren, indem sie diese Menschen für einfache Arbeiten nutzen können, während „Menschen mit niedrigem Einkommen“ diese sowohl auf dem Arbeits- als auch auf dem Wohnungsmarkt als >ungeliebte< Konkurrenten wahrnehmen. Dem „Narrativ eines immer größer werdenden Flüchtlingsstrom(s)“ widerspricht er ausdrücklich, indem er den „Anteil von Migranten und Flüchtlingen (für) stabil“ erklärt – auch wenn es „immer wieder Ausreißer nach oben“ gibt – dieser liege bei „0,35% der Weltbevölkerung“. Während und nach dem 2.Weltkrieg hätte es „sogar deutlich mehr Vertriebene als heute“ gegeben.
Einwanderungsbeschränkungen führen zu mehr Einwanderung
Als Beispiel für seine erste These führt er die türkische Einwanderung in den 60er und 70er Jahre in der Bundesrepublik an. Als die Bundesregierung 1973 einen Anwerbestopp von türkischen Gastarbeitern beschloss, beschlossen viele türkische Gastarbeiter – die zunächst nur für einen überschaubaren Zeitraum in der Bundesrepublik Geld verdienen wollten – „nicht mehr zurückzukehren. Sie holten ihre Familien nach.“ Mit der Drohung nie wieder zum Geldverdienen in die Bundesrepublik hineingelassen zu werden, führte zu der paradoxen Reaktion des sich in der Fremde ein Zuhause einzurichten. Genau das gleiche Prinzip lässt sich bei der europäischen Migrationspolitik beobachten: die Drohung einer >Festung Europa<, einer Abschottung durch das Dichtmachen der Außengrenzen setzt einen erhöhten Einwanderungswunsch arbeitssuchender Afrikaner und Asiaten in Gang.
„Die goldene Regel für effektives Migrationsmanagement lautet deshalb: Wir müssen unsere Arbeitsmarktpolitik und unsere Einwanderungspolitik aufeinander ausrichten.“
Für diese Forderung gibt es für de Haas drei simple Gründe: 1. Überalterung unserer Gesellschaften, 2. Keine Lust der einheimischen Bevölkerung auf Hilfsjobs und 3. Die Emanzipation der europäischen Frau. Es bedarf eben nicht nur die in aller Welt angeworbenen Fachkräfte, sondern es gibt einen sehr großen Bedarf an minder qualifizierten Arbeitnehmern. In diesem Zusammenhang macht de Maas einen (typisch englischen) Witz: „Oder, um es überspitzt zu sagen, die Zuwanderung ließe sich am wirkungsvollsten verringern, indem man das Wirtschaftswachstum anhält.“ Es geht also darum, „legale Einwanderungsmöglichkeiten“ (!) zu schaffen für genau jene Arbeitssuchenden, die der Arbeitsmarkt auch braucht. Hierfür bedarf es einer stärkeren Arbeitsmarktkontrolle.
Geschlossene Grenzen, Grenzzäune und Grenzbeamten sind bei einer zehntausende Kilometer langen Mittelmeerküste nur der „Anschein von Kontrolle“ – ein Zitat des US-Migrationsforschers Douglas Massey, den de Haas als Unterstützung seiner zweiten These einer >Symbolpolitik< zitiert. Sowohl Abschiebeflüge, die in UK „Kosten (von) 1,9 Mio. Euro pro Kopf“ verursacht haben, halten keine Migranten davon ab, zu uns zu kommen, als auch die Milliarden Euro für die Türkei, Libyen, Marokko und Tunesien, verhindern nicht den Versuch per Boot über das Mittelmeer in Europa zu landen.
Ein ewiges „Katz-und-Maus-Spiel“ von Schleppern und Grenzern
Auf die Frage von Steffen Lüdke, was de Maas mit der Behauptung einer „moralischen Bankrotterklärung der europäischen Migrationspolitik“ meine, führt dieser die Abschottungs- und Rückführungsmaßnahmen als „Fake-Lösungen“ an. Auch „die Rhetorik“ zu diesen Maßnahmen ist ganz verkehrt, weil sie „unsere Gesellschaften spaltet“. Es ist ein „Teufelskreis“, aus dem ausgebrochen werden müsse. Es ist die „Abschottung“ – so seine dritte These -, die die „Dienstleistung“ eines Schleppers notwendig macht: „Wer das Recht auf Asyl wahrnehmen möchte, braucht einen Schlepper.“ Es sind die fehlenden legalen Einwanderungsmöglichkeiten, die das Geschäft der Schlepper florieren lassen.
So fasst de Haas am Ende des Interviews noch mal zu zusammen, dass es darum gehen müsse, in unseren Gesellschaften zu klären, 1. wie wir mit dem Arbeitskräftemangel im sozial-caritativen Bereich (Kinder, Kranke, Alte) umgehen wollen, 2. Wie wir die „Marginalisierung (Verdrängung an den Rand der Gesellschaft) von Zugewanderten und 3. die damit einhergehenden Integrationsprobleme „verhindern“ wollen. In diesem Zusammenhang hofft er auf eine „neue Generation von Politikern“, für die der Sachverhalt, dass es „schon immer Migration (gab), sie immer geben (wird)“ eine unbestreitbare Tatsache ist. Dies hält de Haas für einen Teil einer größeren, umfassenderen Debatte darüber, „in was für einer Gesellschaft wir leben wollen.“